Sekundäre Sterilität:
Es tut weh, wenn das zweite Kind nicht kommt
Wer bereits ein Kind hat, erwartet oft, dass eine weitere Schwangerschaft genauso unkompliziert eintritt. Doch was, wenn es plötzlich nicht mehr klappt? Wenn der ersehnte zweite oder dritte Nachwuchs ausbleibt – trotz aller Bemühungen? Diese Situation nennt die Medizin sekundäre Sterilität – die Unfähigkeit, nach der Geburt eines oder mehrerer Kinder erneut schwanger zu werden. Schätzungen zufolge betrifft dieses Problem etwa 8 % der Paare in Industrieländern.
Trotz der Häufigkeit wird selten über die emotionale Last gesprochen, die damit einhergeht. Viele Betroffene fühlen sich unverstanden, da ihr Umfeld oft meint: „Seid doch dankbar, ihr habt ja schon ein Kind.“ Doch der unerfüllte Wunsch bleibt – und mit ihm Trauer, Zweifel und die Frage: Warum ausgerechnet wir?
In diesem Artikel beleuchte ich Ursachen der sekundären Unfruchtbarkeit sowie psychische Herausforderungen, die damit einhergehen. Dabei zeige ich sowohl medizinische Wege als auch Ansätze zur Entlastung und Stärkung der Psyche auf, um Betroffenen neue Perspektiven zu geben.
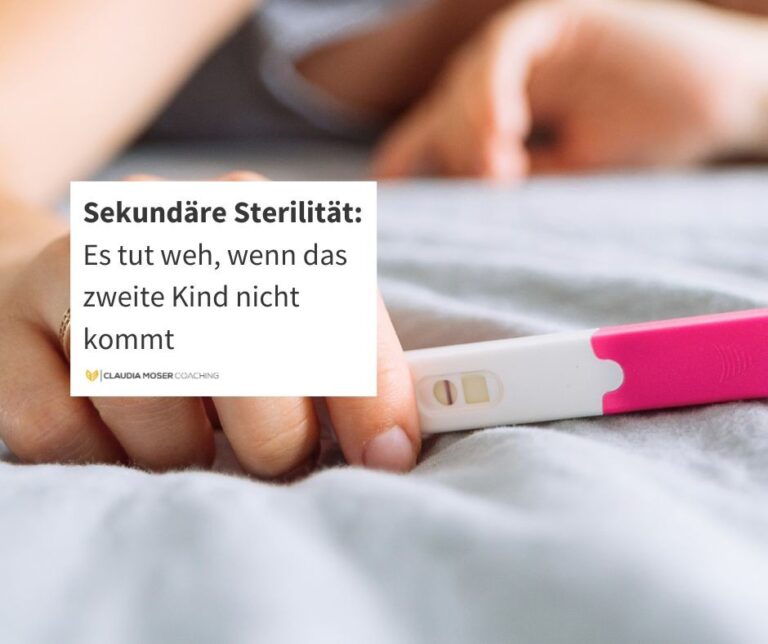
Übersicht
Vorweg
Eines Tages kam eine Frau in mein Coaching, die sich ein zweites Kind wünschte – eine neue Situation für mich, da ich bis dahin ausschließlich ungewollt kinderlose Menschen beraten hatte. Aufgrund einer Erkrankung war eine weitere Schwangerschaft für sie ausgeschlossen. Diese Endgültigkeit belastete sie sichtlich, dennoch entschuldigte sie sich beinahe reflexartig. Sie war unsicher, ob sie überhaupt das Recht hatte traurig zu sein, da sie bereits Mutter war.
Diese Frage stellen sich vermutlich viele Betroffene. Meine Haltung dazu ist klar: Der Wunsch nach einem weiteren Kind ist genauso legitim wie der nach dem ersten. Unerfüllte Kinderwünsche – egal ob es um das erste, zweite oder dritte Kind geht – bringen ganz eigene Herausforderungen mit sich. Doch eines bleibt gleich: die emotionale Belastung, die Zweifel und die Trauer. Jedes nicht realisierbare Wunschkind hinterlässt eine Lücke, die gesehen und ernst genommen werden soll.
1. Ursachen einer sekundären Sterilität
Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, die eine weitere Schwangerschaft behindern können. Selbst wenn es beim ersten Kind problemlos geklappt hat, kann eine zweite Schwangerschaft erschwert sein. Hier sind einige mögliche Ursachen genannt:
a) Weibliche Faktoren der Fruchtbarkeit
Mit zunehmendem Alter nimmt die Eizellqualität ab, und die Eizellreserve verringert sich. Während die Wahrscheinlichkeit, in einem Zyklus schwanger zu werden, im Alter von 30 Jahren noch bei etwa 20 bis 25 % liegt, sinkt sie mit 35 Jahren auf etwa 10 bis 15 % und mit 40 Jahren auf etwa 5 %. Diese Werte können je nach Quelle variieren, aber die allgemeine Tendenz einer abnehmenden Fruchtbarkeit mit steigendem Alter ist eindeutig. Die stetig steigende Lebenserwartung ändert daran leider nichts.
Neben dem Alter können auch Erkrankungen wie PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom) oder Endometriose die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und eine sekundäre Sterilität verursachen. Auch Hormonveränderungen oder Schilddrüsenprobleme können sich auf eine erneute Schwangerschaft auswirken.
b) Komplikationen nach der ersten Schwangerschaft
Narbengewebe nach einem Kaiserschnitt, Infektionen, komplizierte Operationen oder Schäden an der Gebärmutter, den Eileitern oder den Eierstöcken während früherer Schwangerschaften können zu Unfruchtbarkeit führen.
c) Männliche Faktoren der Fruchtbarkeit
Auch die Spermienqualität nimmt mit dem Alter ab, wenngleich dieser Prozess im Vergleich zu Frauen langsamer und weniger linear verläuft. Darüber hinaus können Stress, Umweltgifte oder hormonelle Veränderungen die Spermienqualität negativ beeinflussen.
d) Ungesunder Lebensstil
Ungesunde Lebensgewohnheiten können die Fruchtbarkeit sowohl bei Männern als auch bei Frauen beeinflussen. Rauchen, Alkohol, unausgewogene Ernährung, zu hohes oder zu geringes Körpergewicht und übermäßiger Stress können die Chancen auf eine Empfängnis verringern. Auch ein veränderter Schlafrhythmus durch das erste Kind kann sich negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken.
2. Medizinische Unterstützung
a) Diagnostische Untersuchungen
Medizinische Untersuchungen beider Partner können helfen, die Ursachen einer sekundären Sterilität zu identifizieren. Das bringt Klarheit und führt im besten Fall dazu, dass durch unterstützende Maßnahmen die Chance auf eine Schwangerschaft verbessert werden kann. Zu den diagnostischen Methoden zählen unter anderem ausführliche Anamnesegespräche, Hormonanalysen, Spermiogramme, Ultraschalluntersuchungen und genetische Untersuchungen.
Es stellt sich die Frage, wann man ärztlichen Rat suchen sollte, wenn man ein zweites Mal schwanger werden möchte:
- Frauen bis zum 35. Lebensjahr wird empfohlen, nach einem Jahr erfolgloser Versuche ärztlichen Rat einzuholen.
- Frauen zwischen 36 und 39 wird empfohlen, nach sechs Monaten Hilfe zu suchen. Wenn andere Faktoren bekannt sind auch früher.
- Frauen über 40 wird empfohlen, sich so bald wie möglich untersuchen zu lassen, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.
- Männern sei empfohlen, sich ebenfalls einer Untersuchung zu unterziehen, sobald sich ihre Partnerinnen untersuchen lassen. Denn die Gesamtsituation lässt sich erst dann aussagekräftig beurteilen, wenn beide Partner untersucht wurden.
b) Medizinische Kinderwunsch-Behandlung
Methoden wie intrauterine Insemination (IUI), In-vitro-Fertilisation (IVF) oder die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) können trotz sekundärer Unfruchtbarkeit helfen, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Bei einer geringen Eizellreserve der Frau kommt eventuell eine Eizellspende in Frage. Diese Alternative ist in Deutschland bisher verboten. Zulässig hingegen ist die Samenspende, die bei einem auffälligen Spermiogramm des Mannes ein Ausweg sein kann.
c) Alternative und ergänzende Therapieansätze
Es gibt eine ganze Reihe von alternativen oder ergänzenden Therapieangeboten bei sekundärer Unfruchtbarkeit. Unter anderem sind das Akupunktur, Osteopathie, Homöopathie, Ernährungsberatung und eine gezielte Lebensstilveränderung.
Die Vielzahl an untersützenden Therapien und Maßnahmen macht es Betroffenen nicht leicht, den eigenen, stimmigen Weg im Dschungel der Möglichkeiten zu finden.
3. Emotionale und psychische Belastungen
a) Enttäuschung und Trauer
Der Wunsch nach einem weiteren Kind ist oft tief verwurzelt. Eine Klientin sah sich schon seit ihrer Jugend umgeben von vielen Kindern, die laut durchs Haus tollen. In Erwartung einer großen Familie haben sie und ihr Mann ein großes Haus gebaut. Heute lebt die Familie dort zu Dritt mit der kleinen Tochter. „Die übrigen Zimmer waren lange ein Problem für mich“, sagt sie.
Wenn der Wunsch nach mehr Kindern unerfüllt bleibt, erleben Betroffene Trauer, die mit der eines Verlustes vergleichbar ist.
b) Schuldgefühle und Selbstzweifel
Eltern, die sich ein zweites Kind wünschen, erleben oft unterschiedliche Aspekte des Schuldgefühls. Einerseits fühlen sie sich gegenüber ihrem ersten Kind schuldig, da sie befürchten, dass es vielleicht nie ein Geschwisterkind haben wird und dadurch in seiner Entwicklung benachteiligt sein könnte. Andererseits fühlen sie sich schuldig, weil sie das Gefühl haben, nicht genug dankbar zu sein, da sie bereits ein Kind haben. „Ich weiß“, sagte eine Klientin, „ich sollte dankbar dafür sein, dass ich überhaupt ein Kind habe. Das bin ich auch, und trotzdem sehne ich mich nach einem weiteren Kind. Das macht mich fertig.“
Viele Betroffene fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben – durch falsche Ernährung, Stress oder das spätere Kinderkriegen. Dazu kommen Zweifel, ob Komplikationen bei der Geburt des ersten Kindes oder nachfolgende Operationen die Ursache für das Ausbleiben einer weiteren Schwangerschaft sind. Diese Gedanken gehen oft mit der quälenden Frage einher, ob etwas hätte vermieden werden können. All diese Facetten des Schuldgefühls verstärken die emotionale Belastung.
c) Sozialer Druck und Unverständnis
Das Umfeld unterschätzt häufig, dass der unerfüllte Wunsch nach einem weiteren Kind eine tiefe psychische Belastung darstellt. Kommentare wie „Sei doch froh, dass du überhaupt ein Kind hast!“ oder „Vielleicht soll es einfach nicht sein“ können verletzend sein. Keinesfalls helfen sie.
d) Neid auf andere
Freunde und Familienmitglieder, die problemlos mehrere Kinder bekommen, können das Gefühl der Einsamkeit und Enttäuschung verstärken. Geburtseinladungen oder Schwangerschaftsverkündungen treffen in dieser Situation wie spitze Pfeile. Eine Klientin vereinbarte mit ihren Freundinnen, Schwangerschaften zuerst per WhatsApp zu verkünden. Sie hatte Angst, im Beisein der anderen die Fassung zu verlieren und wollte die Nachricht zuerst allein sacken lassen. „Ich freue mich für jedes Paar, das ein Kind bekommt“ sagt sie, „gleichzeitig bin ich neidisch und traurig und empfinde es als ungerecht, dass wir das durchmachen müssen.“
e) Herausforderungen für die Partnerschaft
In einer Partnerschaft kann es unterschiedliche Perspektiven geben: Während die eine Seite hoffnungsvoll bleibt und nach weiteren medizinischen Möglichkeiten sucht, fühlt sich die andere vielleicht frustriert oder entmutigt. Während sich der eine mit einer kleinen Familie arrangiert, wünscht sich der andere mehr Trubel im Haus. Zudem geht jeder Mensch anders mit belastenden Gefühlen und Gedanken um, was zusätzliche Herausforderungen und Missverständnisse mit sich bringen kann.
f) Gesellschaftliches Tabu und fehlende Sensibilität
Der unerfüllte Wunsch nach einem Geschwisterkind wird in öffentlichen Diskussionen noch seltener thematisiert als die ungewollte Kinderlosigkeit. Viele Betroffene ziehen es vor, ihren Schmerz für sich zu behalten, anstatt darüber zu sprechen. Doch nicht nur die Stille belastet – sie sehen sich auch mit gesellschaftlichen Vorurteilen konfrontiert. So wird oft angenommen, dass Einzelkinder egoistischer seien als solche, die Geschwister haben. Außerdem müssen sie sich immer wieder neugierige Fragen zur weiteren Familienplanung gefallen lassen, vor allem, wenn ihr erstes Kind älter wird.
g) Psychische Folgen
Wen die Sehnsucht nach einem weiteren Kind dauerhaft belastet, kann chronischen Stress entwickeln. Das kann wiederum die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen, psychosomatische Erkrankungen hervorrufen oder Depressionen auslösen. Eine Klientin sagte, dass sie so glücklich war, als ihr erstes Kind nach langer Wartezeit geboren wurde. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass die Hoffnung auf ein weiteres Kind wieder diese Achterbahn der Gefühle und diesen Schmerz auslösen würde.
4. Entlastung und Stärkung der Psyche
a) Raus aus dem Stress
Die emotionale Belastung eines unerfüllten Kinderwunsches kann sich in Stress, Schlafstörungen und körperlicher Anspannung zeigen. Es tut gut, Pausen einzulegen, in denen der Kinderwunsch nicht im Mittelpunkt steht. Manche Paare legen fest, in welchen Monaten sie sich aktiv um eine Schwangerschaft bemühen und in welchen sie sich davon erholen. Andere setzen auf bewusste Regeneration – sei es durch Reisen, Sport oder kreative Aktivitäten. Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Scham oder Angst sind unangenehm und anstrengend. Viele meiner Klientinnen und Klienten haben lange versucht, ihre belastenden Emotionen zu unterdrücken und mit sich selbst auszumachen, was den empfundenen Druck nur noch verstärkt. Auch wenn es etwas Mut braucht zu den eigenen Emotionen zu stehen – es ist ein unverzichtbarer Schritt, um innere Ruhe und Stabilität zurückzugewinnen.
b) Die Perspektive erweitern
Wer lange auf ein weiteres Kind hofft, sieht oft nur den einen Weg: schwanger werden. Es tut gut, die Perspektive wieder zu erweitern. Ein Paar berichtete, dass es nach Jahren des Bangens beschloss, das Familienleben so zu genießen, wie es war – mit ihrem Kind zu dritt. „Wir haben uns entschieden, unseren Fokus zu verändern. Statt weiter zu hoffen, dass es irgendwann klappt, haben wir Pläne für die Zukunft geschmiedet, unabhängig von einer Schwangerschaft.“ Diese Neuausrichtung bedeutet nicht, den Wunsch aufzugeben, sondern ihm eine neue Bedeutung zu geben. Es geht nicht darum, zwanghaft positiv zu denken, sondern darum, sich die Erlaubnis zu geben, andere Lebensentwürfe in Betracht zu ziehen – ohne das Gefühl, dabei etwas aufzugeben.
c) Starker Selbstwert
Ein unerfüllter Kinderwunsch kann am Selbstwertgefühl nagen. Manche Frauen fragen sich, ob mit ihrem Körper etwas „nicht stimmt“. Manche Männer hadern mit dem Gefühl, als Mann zu versagen. Das nagt an der eigenen Identität. Doch ein Mensch ist weit mehr als seine Fruchtbarkeit. Der Selbstwert sollte nicht davon abhängen, ob ein weiterer Kinderwunsch in Erfüllung geht. Sich selbst mit all seinen Facetten wertzuschätzen, kann dabei helfen, sich nicht über das zu definieren, was fehlt, sondern über das, was bereits da ist.
d) Starkes soziales Umfeld
Das soziale Umfeld spielt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung eines unerfüllten Kinderwunsches, da die gegenseitige Unterstützung von Partner und Partnerin, ihren Familien und Freunden eine wichtige Stütze darstellt. Eine starke soziale Unterstützung führt zu niedrigeren Stresswerten und trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden sowie die Partnerschaft zu minimieren (J. Alder). Ein starkes soziales Netzwerk bedeutet dabei nicht, jedem alles anzuvertrauen, sondern gezielt diejenigen Menschen einzubeziehen, die guttun.
5. Alternative Lebensentwürfe
a) Adoption und Pflegekinder
Für manche Paare kann die Adoption oder die Aufnahme eines Pflegekindes eine erfüllende Alternative sein. Nicht als Ersatz für ein weiteres, eigenes Kind, sondern mit der Absicht, anderen Kindern das Aufwachsen in einer Familie zu ermöglichen.
b) Akzeptanz der Situation
Akzeptanz bedeutet nicht, etwas gutheißen. Akzeptieren bedeutet, die Realität bewusst zu erkennen und anzunehmen – ohne Wenn und Aber. Daraus entwickelt sich die Kraft, das Leben aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.
Als eine Klientin die Enttäuschung über das ausbleibende zweite Kind verarbeitet hatte, konnte sie eine tiefe Dankbarkeit für ihre Tochter spüren. Dieses Gefühl gab ihr den inneren Frieden, den sie lange gesucht hatte. Jetzt kam die Energie zurück und sie war bereit, nach vorne zu schauen, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen und sich neuen Dingen zu öffnen.
Quelle: Judith Alder, Ratgeber unerfüllter Kinderunsch (2022)
Weitere Artikel zum Thema „unerfüllter Kinderwunsch“ findest du im Kinderwunsch Blog von Claudia Moser.
Die Autorin
Claudia Moser ist Systemische Coach und ausgebildete PEP®-Anwenderin. Sie hilft Menschen mit Kinderwunsch dabei, Stress abzubauen und zuversichtlich und selbstbestimmt den eigenen Weg zu finden. Claudia kennt die Herausforderungen eines unerfüllten Kinderwunsches aus dem eigenen Leben. Sie lebt mit ihrem Mann in Karlsruhe, liebt Trekkingtouren im Himalaya und spontane Kochabende mit Freunden.


